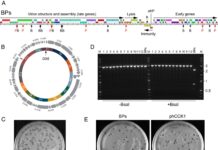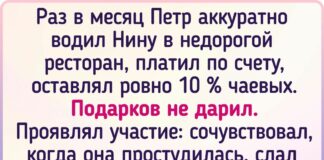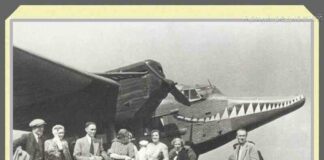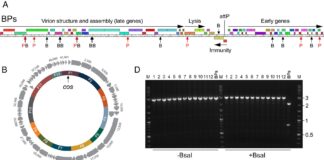Während sich die Staats- und Regierungschefs der Welt zur COP30 in Brasilien versammeln, liegt ein Déjà-vu-Gefühl in der Luft. Vor einem Jahrzehnt posierte eine Schar Würdenträger vor dem Banner „COP21 Paris“ und strahlte den Optimismus aus, der der globalen Einheit gegen den Klimawandel entspringt. Doch dieses Jahr sieht das Treffen völlig anders aus: Xi Jinping und Narendra Modi sind ebenso abwesend wie etwa 160 weitere Staatsoberhäupter. Und vielleicht am aufschlussreichsten ist, dass Donald Trump ein eklatantes Versäumnis darstellt, da er die USA vollständig aus dem Pariser Abkommen zurückgezogen hat, was viele dazu veranlasst, die Relevanz des Gipfels in dieser neuen politischen Landschaft in Frage zu stellen.
Das Fehlen dieser Schlüsselakteure spricht Bände über die sich verschiebenden Prioritäten auf der globalen Bühne. Während COP-Gipfeltreffen einst als Plattformen für multilaterale Diplomatie und Klimaschutzverpflichtungen gedacht waren, befinden sie sich heute in einem Tauziehen zwischen konkurrierenden nationalen Interessen.
Christiana Figueres, die den UN-Klimaprozess während der bahnbrechenden Verhandlungen zum Pariser Abkommen leitete, erklärte letztes Jahr unverblümt, dass der COP-Prozess „nicht zweckmäßig“ sei. Joss Garman, Gründer des Think Tanks Loom und ehemaliger Klimaaktivist, teilt diese Meinung: „Das goldene Zeitalter der multilateralen Diplomatie ist vorbei. In der Klimapolitik geht es heute mehr denn je darum, wer die wirtschaftlichen Vorteile der neuen Energieindustrien nutzt und kontrolliert.“
Dieser Wandel wurde zum Teil durch Präsident Trumps aggressives Streben nach der Vorherrschaft bei fossilen Brennstoffen vorangetrieben, eine Strategie, die er vertritt, um Amerika zur weltweit führenden Energiesupermacht zu machen. Er hat Initiativen für saubere Energie aktiv abgebaut, Umweltvorschriften zurückgenommen und andere Länder aggressiv dazu gedrängt, amerikanisches Öl und Gas zu kaufen. Im krassen Gegensatz zu diesem „Energy First“-Ansatz geht China seinen eigenen Weg und nutzt seine enormen Produktionskapazitäten, um weltweit führend in der Technologie für erneuerbare Energien zu werden.
Die Ironie ist Experten nicht entgangen: China hat mittlerweile die Oberhand bei Solarpaneelen, Windkraftanlagen, Elektrofahrzeugen und fortschrittlichen Batterien – alles zu unglaublich niedrigen Preisen. Das Ergebnis? Die europäischen Nationen kämpfen mit dem Dilemma, ob sie ihre Märkte öffnen und den Zusammenbruch heimischer Industrien riskieren oder die Türen zuschlagen und möglicherweise die Ziele im Bereich der grünen Energie gefährden sollen.
Bei diesem Wettbewerb zwischen traditionellen Interessen an fossilen Brennstoffen und schnell aufstrebenden Giganten im Bereich sauberer Energie geht es nicht nur um Technologie; es stellt einen grundlegenden Kampf um wirtschaftliche und geopolitische Macht dar.
Angesichts solch erdbebenartiger Veränderungen in der globalen Dynamik stellt sich die Frage: Was bleibt für die COP30 noch zu erreichen? Während einige argumentieren, dass jährliche Gipfeltreffen überflüssig geworden sind, glauben andere, dass diese Zusammenkünfte als Foren, um Länder für ihre Verpflichtungen zur Rechenschaft zu ziehen und anhaltende politische Unterstützung für Klimaschutzmaßnahmen zu signalisieren, weiterhin von entscheidender Bedeutung sind.
Vielleicht steht ein noch bedeutenderer Wandel bevor: COPs könnten sich zu kleineren, fokussierten Treffen entwickeln, die sich mit spezifischen Herausforderungen befassen, etwa der Finanzierung grüner Infrastruktur oder dem Abbau von Handelshemmnissen bei sauberen Energietechnologien. Dies wäre eine strategische Neuausrichtung – weg von allgemeinen Zusagen und hin zu konkreten Maßnahmen vor Ort, die durch bilaterale Abkommen und private Investitionen und nicht nur durch internationale Abkommen vorangetrieben werden.
Die Wahrheit ist, dass die COP30 mehr darüber offenbaren wird, wer hinter welcher Seite dieses aufkommenden globalen Paradigmas steht: diejenigen, die die Hegemonie der fossilen Brennstoffe anstreben oder sich Chinas Revolution im Bereich der sauberen Energie anschließen. Diese Schwerpunktverlagerung könnte durchaus nicht nur die Zukunft des Klimaschutzes, sondern auch die breitere geopolitische Landschaft der kommenden Jahrzehnte prägen.