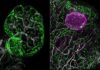Seit Jahren wird postpartale Depression (PPD) größtenteils als ein mütterliches Problem verstanden. Es gibt jedoch immer mehr Belege dafür, dass Väter in etwa genauso häufig an PPD leiden wie Mütter – etwa 8,4 % gegenüber 13 % – und dass die Folgen schwerwiegend sein können. Diese übersehene Krise der psychischen Gesundheit erhält nun längst überfällige Aufmerksamkeit, da die Forschung das Ausmaß des Problems offenlegt und die Notwendigkeit maßgeschneiderter Vorsorgeuntersuchungen und Behandlungen hervorhebt.
Der stille Kampf: Warum die väterliche PPD übersehen wurde
Viele Väter leiden im Stillen und glauben oft, sie sollten sich auf die Unterstützung ihrer Partner konzentrieren, anstatt ihre eigenen Probleme zum Ausdruck zu bringen. Mat Lewis-Carter, ein in London ansässiger Personal Trainer, erinnert sich, dass er nach der Geburt seiner Tochter in Selbstmordgedanken geriet und den Begriff „PPD bei Vätern“ nur zufällig auf Seite drei der Google-Suchergebnisse entdeckte. Diese Verzögerung bei der Erkennung unterstreicht ein systemisches Problem: Bis vor Kurzem wurde väterliche PPD selten diskutiert, untersucht oder behandelt.
Der Mangel an Bewusstsein ist kein Zufall. Die frühe Mutterschaft ist schwierig und die Ressourcen für Mütter haben sich verbessert. Allerdings hinken die Leistungen für Väter weit hinterher. In England verfügen nur 20 % der NHS-Trusts über spezielle Ressourcen für die perinatale psychische Gesundheit von Vätern, während in Australien mehr als ein Drittel der Erstväter mit Hindernissen beim Zugang zu medizinischer Versorgung konfrontiert sind. Im Bericht der WHO aus dem Jahr 2022 wurde eingeräumt, dass Partner häufig das Gefühl haben, kein Recht auf Unterstützung zu haben.
Die tödlichen Risiken: Selbstmord und Auswirkungen auf die Familie
Aktuelle Studien schlagen Alarm. Untersuchungen der Swansea University ergaben, dass die Selbstmordraten bei frischgebackenen Vätern siebenmal höher sind als bei Müttern. Über die unmittelbare Gefahr hinaus hat eine unbehandelte PPD bei Vätern weitreichende Auswirkungen und wirkt sich auf die sozial-emotionale Entwicklung der Kinder aus. Diese Erkenntnis führt zu einem Wandel in der Politik und der Unterstützung.
Fehlerhafte Tools und bessere Alternativen
Aktuelle Diagnosemethoden sind oft unzureichend. Die Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), das gebräuchlichste Screening-Instrument, wurde für Mütter entwickelt und kann wichtige männliche Symptome wie Reizbarkeit, Substanzkonsum oder Entzug übersehen. Studien in Österreich und Singapur zeigen, dass männerspezifische Skalen wie die Male Depression Risk Scale und die Gotland Male Depression Scale genauere Erkennungsraten bieten.
Experten empfehlen Ärzten, vom EPDS Abstand zu nehmen, insbesondere in Kulturen, in denen Männer dem Druck ausgesetzt sind, Emotionen zu unterdrücken. Eine Studie aus dem Jahr 2025 in Singapur ergab, dass männliche Depressionsskalen Fälle mit einer um 50 % höheren Rate erkannten als das EPDS.
Reframing-Behandlung: Jenseits der traditionellen Therapie
Traditionelle Interventionen wie Medikamente und Einzeltherapie werden von Vätern seltener in Anspruch genommen. Manche betrachten die Therapie als entmannend, und Studien deuten darauf hin, dass sie bei Männern möglicherweise weniger wirksam ist. Forscher des kanadischen University Health Network leisten Pionierarbeit bei gruppenbasierten psychosozialen Interventionen und bezeichnen sie als „Trainingsprogramme“ und nicht als Therapie zur Reduzierung von Stigmatisierung.
Erste Ergebnisse zeigen, dass diese Interventionen nicht nur depressive Symptome reduzieren, sondern auch das Wohlbefinden der Kinder verbessern. Andere Ansätze umfassen „männerfreundliche“ Therapiesitzungen, die die männliche Eigenständigkeit bestätigen und gleichzeitig schädliche Normen sanft in Frage stellen.
Proaktive Prävention: Die Rolle der Technologie
Die Zukunft liegt in der Prävention. Selbstgesteuerte Online-Programme, die für Mütter bereits erfolgreich sind, werden jetzt für Väter angepasst. Australiens SMS4dads, ein kostenloser SMS-Dienst, sendet regelmäßig Check-ins an junge und werdende Väter. Erste Studien deuten darauf hin, dass es die Isolation verringert und das Hilfesuchverhalten fördert. Ähnliche Programme werden in Europa und Afrika erprobt.
Die Forschung weist auch auf biologische Faktoren hin, wie etwa hormonelle Veränderungen bei Vätern (niedrigerer Testosteronspiegel, höherer Östrogenspiegel) und die Auswirkungen der psychischen Gesundheit der Partner. Eine aktuelle Studie ergab einen 81-prozentigen Anstieg der PPD bei Vätern, deren Partner ohne Vorgeschichte eine postpartale Depression entwickelten. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer familienzentrierten Betreuung.
Politische Veränderungen und Zukunftsaussichten
Die Dynamik nimmt zu. Das Vereinigte Königreich hat kürzlich seine erste Männergesundheitsstrategie auf den Weg gebracht, und Australien hat eine Ministerkabinettsposition geschaffen, die die Gesundheit von Männern überwachen soll. Diese Änderungen, kombiniert mit laufender Forschung und verbesserten Screening-Instrumenten, deuten auf eine längst überfällige Abrechnung mit väterlicher PPD hin.
Das Stigma bleibt bestehen, aber das Bewusstsein wächst. Während Forscher die Komplexität männlicher Depressionen entschlüsseln und politische Entscheidungsträger der psychischen Gesundheit von Männern Priorität einräumen, erhalten Väter endlich die Unterstützung, die sie verdienen.